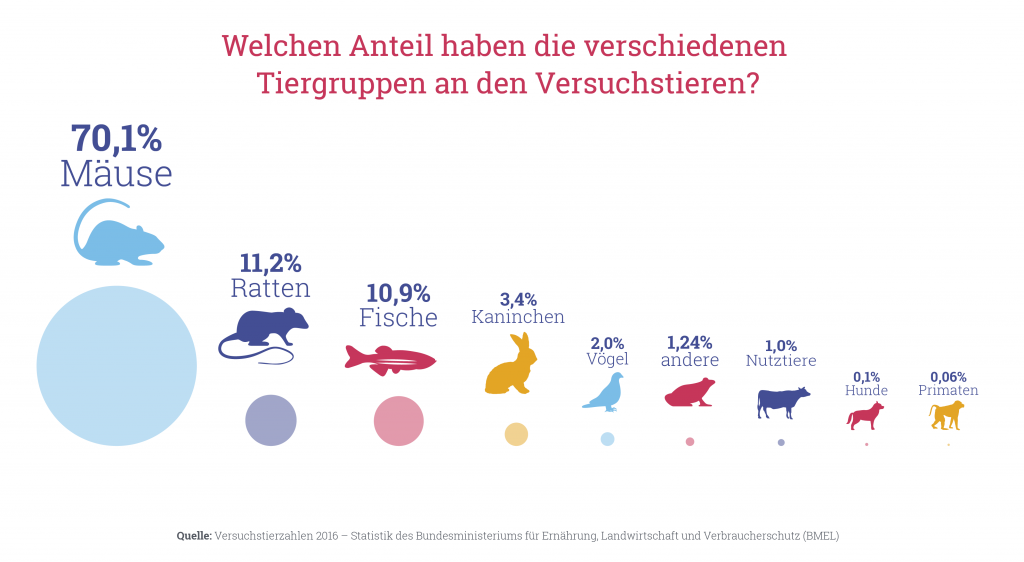Die Wissenschaftler Prof. Andreas Nieder und Prof. Hans-Peter Thier (Universität Tübingen) forschen an Primaten. Im Interview mit „Tierversuche verstehen“ erklären sie, wie wichtig die Forschung an Affen für das Verständnis vieler Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz ist.
Was erforschen Sie mit Hilfe von Primaten? Und wie wichtig ist Ihre Forschung für den medizinischen Fortschritt?
Prof. Andreas Nieder: Wir forschen am Primatenmodell, weil wir uns davon Rückschlüsse auf grundlegende Mechanismen der Erzeugung von für den Menschen zentralen Gehirnleistungen versprechen. Vieles funktioniert bei nicht-humanen Primaten – also Affen – ganz ähnlich wie bei uns Menschen, aber anders als bei vielen anderen Tieren.

Prof. Hans-Peter Thier: Ein Beispiel ist das Sehsystem, an dem in Tübingen viel geforscht wird: Im Unterschied etwa zu Nagern, für die der Geruchs- und der Tastsinn besonders wichtig sind, sind Menschen und nichthumane Primaten „Augentiere“. Sie sehen die Dinge mit höchster Auflösung, dreidimensional und in Farbe und haben eine hochspezialisierte Augenmotorik. Sie erlaubt es ihnen, ihre leistungsfähigen Augen optimal auszurichten. Auch die Fähigkeit, unsere Hände einzusetzen, um Dinge zu ergreifen, sie zu manipulieren und sie dadurch „begreifbar“ zu machen, teilen wir – zumindest in Ansätzen – mit nichthumanen Primaten. Und das gilt nicht zuletzt auch für unsere Fähigkeit, in größeren Gruppen zusammenzuleben und komplexe soziale Interaktionen zu unterhalten. Wie viele unserer Forscherkollegen sind wir auf die Untersuchung von Affen angewiesen, weil wir uns für die Grundlagen höherer Hirnleistungen interessieren, die Menschen zumindest in Ansätzen mit nichtmenschlichen Primaten teilen. Forscher können diese nicht adäquat an anderen Modellsystemen untersuchen.
Prof. Nieder: Medizinischer Fortschritt wird nur möglich, wenn die Biologie des menschlichen Körpers verstanden wird. Niemand würde erwarten, dass genetische Defekte ohne Kenntnis des genetischen Codes kuriert werden könnten. Und Störungen der Wahrnehmung, der motorischen Kontrolle oder sozialer Interaktionen werden nicht mit Aussicht auf Erfolg angegangen werden können, bevor wir die Mechanismen verstehen, die diesen und vielen anderen komplexen Leistungen unserer Gehirne zugrunde liegen.
Forscher können mittlerweile Organismen mit sogenannten Organoiden simulieren. Warum ist dann noch eine Forschung an Primaten notwendig?
Prof. Nieder: Organoide und „organ-on-a-chip“-Verfahren sind letztlich nichts anderes als komplexere Zellkulturen. Im Unterschied zu konventionellen Kulturen können sie eine gewisse architektonische Ordnung und elementare Versorgungsstrukturen aufweisen. Organoide sind von erheblichem Interesse für die Bearbeitung grundsätzlicher Mechanismen der Entwicklungsbiologie. Sie werden zweifelsohne aber auch eine zunehmende Bedeutung für pharmakologische, toxikologische Probleme oder Fragen der Onkologie und der Infektiologie entwickeln.
Prof. Thier: Aber: Künstliche Systeme, die es ermöglichen würden, komplexe Hirnleistungen und ihre Störungen zu analysieren, müssten die Qualität von Androiden haben, wie sie in Science-Fiction-Filmen vorgestellt werden, beispielsweise in der „Blade Runner“-Reihe. Ungeachtet der interessanten ethisch-philosophischen Implikationen, die sich mit der Frage der Nutzung solcher Androiden ergeben, werden sie wohl auf immer Science Fiction bleiben. Jedenfalls ist das die Schlussfolgerung, die man unvermeidlich ziehen dürfte, wenn man bedenkt, dass das menschliche Gehirn das womöglich komplexeste System im bekannten Universum ist. Es besteht aus über 86 Milliarden Nervenzellen, die selbst schon zu den komplexesten Zellen überhaupt gehören. Und durch deren Vernetzung und Interaktion auf der Grundlage von „Schaltplänen“, die wir allenfalls in Ansätzen verstehen, kommen noch einmal mehrere Größenordnungen an Komplexität hinzu. Tierische Gehirne und insbesondere die von nichthumanen Primaten sind zwar erheblich kleiner als unsere, können aber zumindest grundsätzliche Eigenschaften der Baupläne verstehbar machen.

Prof. Nieder: Die Entwicklung von Ergänzungs- und in wenigen Fällen auch Ersatzmethoden kann zweifelsohne dazu beitragen, die Zahl benötigter Versuchstiere zu reduzieren. Dies ist eine Entwicklung, die von tierexperimentell arbeitenden Forschern ausdrücklich begrüßt wird. Man sollte aber auch mit Blick auf die Nutzung von Organoiden nicht übersehen, dass diese und viele Ersatz- und Ergänzungsmethoden von der Nutzung lebender Gewebe von Tieren abhängen. Um die Zellen zum Wachstum anzuregen, benötigt man zum Beispiel oft fetales Kälberserum, das aus ungeborenen Kälbern gewonnen wird. Die Verwendung von Tieren ist damit weiterhin notwendig.
Prof. Thier: Das Gehirn besser zu verstehen, ist unbedingt nötig, wenn man an die erhebliche Bedeutung von Hirnerkrankungen in unserer Gesellschaft denkt: So leiden etwa 250.000 Menschen allein in Deutschland an der Parkinson-Krankheit, einer neurodegenerativen Erkrankung, die eine schwere Bewegungsstörung nach sich zieht und die Betroffenen zunehmend immobilisiert. Die Alzheimer-Krankheit und verwandte Formen von Demenzen betreffen fast 1,6 Millionen Patienten, die einen zunehmenden Verlust ihrer Fähigkeit erleben müssen, sich zu erinnern, zu planen und zu denken, und die schlussendlich ihrer Persönlichkeit beraubt werden. Neuropsychiatrische Erkrankungen wie etwa Depressionen, Schizophrenie oder Autismus betreffen eine noch weit größere Zahl von Bundesbürgern – und das in vielen Fällen bereits in sehr frühen Phasen ihres Lebens. Die Behandlungsmöglichkeiten bei den meisten dieser Erkrankungen sind schlecht, was Folge unseres noch sehr rudimentären Verständnisses der Wirkungsweise der betroffenen Hirnprozesse ist. Wo es Fortschritte gibt, basieren sie darauf, dass neurowissenschaftliche Grundlagenforschung an den unterschiedlichsten Modellsystemen eine tragfähige Basis für die Entwicklung von therapeutischen Ansätzen geschaffen hat.
Prof. Nieder: Lassen Sie uns das Beispiel der Parkinson-Krankheit betrachten: Hier hat die Forschung an Nagern und an nichtmenschlichen Primaten die entscheidenden Fortschritte bei der Behandlung von Patienten erbracht. Die gängigen pharmakologischen Therapien, von denen vielen Patienten über Jahre ihres Lebens profitieren, sind vor allem an Nagern entwickelt worden. Einer der wirksamsten neueren Behandlungsansätze, von dem vor allem Patienten in späteren Stadien ihrer Erkrankung profitieren, wenn Medikamente an Wirksamkeit verlieren, ist der sogenannte Hirnschrittmacher. Dabei werden Elektroden tief in das Gehirn der Patienten eingebracht, über die bestimmte Hirngebiete mit geringen, für das Organ unschädlichen Strömen erregt werden. Die Symptome der Patienten, wie zum Beispiel Muskelzittern oder die Bewegungseinschränkung, verbessern sich teilweise dramatisch oder verschwinden gar vollständig.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Prof. Thier: Die Operation wird auch in Tübingen durchgeführt, da sind es jährlich bis zu 40 Patienten. Deutschlandweit kommen wir auf vielleicht 500, da die Methode hierzulande noch nicht sehr lange etabliert ist. Weltweit haben sich seit den 90er Jahren aber bereits an die 100.000 Patienten einer Prozedur unterzogen, bei der ihnen in einem chirurgischen Eingriff bei vollem Bewusstsein Elektroden zur tiefen Hirnstimulation eingesetzt werden. Das Wissen über die Wirkung dieser Art der Hirnstimulation ist durch Studien an Affen zu Anfang der 90er Jahre gewonnen worden. Überhaupt stammen große Teile der heute gültigen Theorien über die Entstehung und die Mechanismen der Parkinson-Krankheit aus Forschungen an Primaten. Dieses Beispiel zeigt auch, dass Erkenntnisse an nicht-humanen Primaten sehr wohl auf den Menschen übertragbar sind.

Die Primaten, mit denen Sie forschen, haben Implantate im Kopf. Welchen Zweck hat das und wie schmerzhaft ist das für die Tiere?
Prof. Nieder: Die Implantation selbst ist ein chirurgischer Eingriff, der unter Vollnarkose und unter Bedingungen durchgeführt wird, wie man sie so ähnlich auch in jedem guten Krankenhaus vorfindet. Nach dem Eingriff werden Schmerzmittel verabreicht, bis die Wunde abgeheilt ist. Mit den Tieren wird erst dann gearbeitet, wenn der Heilungsprozess abgeschlossen ist.
Prof. Thier: Die Tiere tragen typischerweise zwei Implantate. Das erste ist ein mit dem Kopf verbundener Metallstift, über den der Kopf des Tieres für die Dauer eines Experiments fixiert werden kann. Dies ist notwendig, um visuelle Reize unter Ausschluss von Kopfbewegungen kontrolliert präsentieren zu können. Ein gut eingeheiltes Implantat verursacht keine Schmerzen und keine Belastung, was ein Blick auf vergleichbare Eingriffe in der Humanchirurgie zeigt. Man denke etwa an die gängige Stabilisierung eines Knochenbruches durch einen sogenannten Fixateur Externe, ein durch die Haut befestigtes Haltesystem aus Metallstangen und Drähten. Im Übrigen werden die Tiere sehr behutsam daran gewöhnt, dass der Kopf für die Dauer des Versuchs nicht bewegt werden kann.
Prof. Nieder: Das zweite Implantat ist ein kleiner Hohlzylinder über der Region im Gehirn, von der Messungen vorgenommen werden sollen. Der Zylinder deckt die eng umschriebene Stelle am Schädel ab, an dem durch Entfernung von Knochen Zugang zum Gehirn geschaffen wurde. An dieser Stelle können Messsonden in das Gehirn eingebracht werden, die so dünn sind, dass sie das Nervengewebe nicht schädigen. Das Einführen der Messsonden verursacht keine Schmerzen, da das Gehirn über keine Schmerzrezeptoren verfügt. Über die Sonden werden die elektrischen Impulse registriert, mit denen Nervenzellen Information verarbeiten und miteinander kommunizieren. Diese elektrischen Impulse von Nervenzellen sind die Währung der Informationsverarbeitung, die Gehirnfunktionen zugrunde liegt: Wahrnehmungsleistungen, Denkprozesse, Lernleistungen und Handlungen. Eine Methode, die solche Nervensignale ohne Einführen von Messsonden ins Gehirn aufzeichnen kann, gibt es nicht.
Prof. Thier: Nichtinvasive Verfahren wie die funktionelle Kernspintomographie oder das EEG messen Globalaktivität von Gehirnregionen und nicht etwa die Aktivität einzelner Nervenzellen oder kleinerer Gruppen. Methoden wie die Kernspintomographie basieren im Übrigen auf einem Surrogatmarker der Hirnaktivität: Das heißt, sie messen nicht die Hirnaktivität selbst, sondern nutzen Blutflusssignale. Deren Beziehung zur Aktivität von Nervenzellverbänden ist komplex und wird bisher nur in Teilen verstanden. Direkte Messungen im Gehirn bleiben deshalb auf absehbare Zeit unersetzlich. Sie sind am menschlichen Gehirn nur in seltenen Ausnahmesituationen und in beschränktem Umfang im Kontext therapeutischer Eingriffe am kranken Gehirn möglich und auf bestimmte Hirnteile beschränkt.
Antworten auf häufig gestellte Fragen haben wir auf der Seite ‚wichtige Fragen und Antworten zu Tierversuchen mit Affen‚ zusammengestellt.