
Abhängig von der wissenschaftlichen Fragestellung werden verschiedene Tierarten in der Forschung eingesetzt. So eignen sich Meerschweinchen zum Beispiel besonders gut für die Untersuchung von Infektionskrankheiten, Rhesusaffen ermöglichen die Erforschung höherer Hirnfunktionen und Zebrafischembryonen erlauben einen umfassenden Einblick in die Zellentwicklung.
Laut der jüngsten Erhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft wurden im Jahr 2019 in Deutschland rund 2,2 Millionen Tiere für wissenschaftliche Zwecke und Sicherheitsprüfungen eingesetzt. Davon waren 69 Prozent Mäuse, gefolgt von Fischen mit 13,6 Prozent. Ratten machten 9,3 Prozent aus und Vögel 1,5 Prozent. 0,12 Prozent der Versuchstiere waren Hunde, 0,1 Prozent Affen und Halbaffen. Menschenaffen werden in Versuchen nicht verwendet.
Mäuse

Mäuse sind die am häufigsten verwendeten Tiere in der Forschung. Durch die Entschlüsselung des Mausgenoms im Jahr 2002 ist bekannt, dass die Gene der Maus und des Menschen zu 98 Prozent übereinstimmen, große Parallelen gibt es insbesondere im Nervensystem und bei der Fortpflanzung. Dadurch sind Mäuse sowohl für die Forschung als auch für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung neuer Medikamente besonders wichtig.
Viele Krankheiten, unter denen der Mensch leidet, findet man auch bei der Maus –beispielsweise Krebs, Infektionen oder Diabetes. Vieles von dem, was wir heute über die Entstehung von Krebs und zu Vorsorgemaßnahmen wissen, ist auf die Forschung an Mäusen zurückzuführen. Durch ihre Hilfe konnten die meisten heute üblichen Krebstherapien und -medikamente entwickelt werden.
Transgene Tiere: Knockout- und Knock-in-Mäuse
Knockout- und Knock-in-Mäuse sind Tiere, bei denen ein oder mehrere Gene ausgeschaltet (knock-out) oder gezielt eingeführt (knock-in) worden sind. Das Resultat sind Änderungen des Erscheinungsbildes der Maus. Das heißt: Je nachdem, welches Gen betroffen ist, sind bei der Maus Veränderungen des Aussehens, des Verhaltens und anderer Charakteristika zu erkennen. Dies wiederum ermöglicht Rückschlüsse auf die Funktionen der veränderten Gene. So können Wissenschaftler mit Knockout- und Knock-in-Mäusen Krankheiten gezielt erforschen. Da wie eingangs erwähnt die Gene von Maus und Mensch zu sehr großen Teilen übereinstimmen, können so Rückschlüsse auf den Menschen gezogen werden,
Insbesondere für die Bereiche Entwicklungsbiologie, Immunologie, Gentechnologie und Gentherapie konnten durch diese Verfahren große Erfolge erzielt werden und beispielsweise Arzneimittel und Therapien gegen Krebs, Herzerkrankungen, Diabetes, Arthritis oder Parkinson entwickelt werden.
Ratten
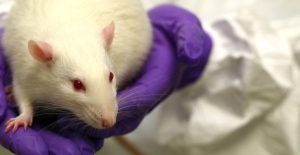
Bereits seit rund 200 Jahren werden in der Forschung Ratten genutzt. Damit zählen sie zu den ersten Säugetieren, die für Tierversuche eingesetzt wurden. Damals zogen Wissenschaftler durch die Arbeit an Ratten Rückschlüsse auf menschliche Körperfunktionen und führten Intelligenzstudien durch. Heute werden die Nagetiere darüber hinaus für die Beantwortung einer großen Bandbreite an wissenschaftlichen Fragen eingesetzt – dazu zählen die Bereiche Krebsforschung, Stoffwechselerkrankungen, Wirksamkeits- und Sicherheitsprüfungen von Medikamenten sowie Verhaltensforschung und Ernährungsstudien.
Wie bei der Maus ist inzwischen auch das Erbgut der Ratte komplett entschlüsselt, das zu 90 Prozent mit dem des Menschen übereinstimmt. Für alle heute bekannten menschlichen Gene, die Krankheiten verursachen, gibt es auch in der Ratte ein entsprechendes Gen. Durch die Forschung an Ratten können Forscher heute zum Beispiel Krankheiten wie Parkinson, Diabetes, Herzinfarkt, psychische Erkrankungen, Verletzungen der Wirbelsäule sowie Bluthochdruck besser verstehen. Das ist die Voraussetzung, um wirksame Therapien zu entwickeln.
Auch wenn Ratten viele Gemeinsamkeiten mit Mäusen aufweisen, eignen sie sich zur Klärung einiger wissenschaftlichen Fragestellungen besser. So ist ihre Fähigkeit zu lernen und Aufgaben zu erfüllen dem Menschen ähnlicher, weshalb Ratten für bestimmte Aspekte der Verhaltensforschung gut geeignet sind.
Affen

Es gibt komplexe wissenschaftliche Fragestellungen, zum Beispiel zu Alterungsprozessen, Funktionen des Gehirns oder der Fortpflanzung, die sich nur durch die Forschung an Affen beantworten lassen.
0,1 Prozent der Versuchstiere sind nicht-menschliche Primaten (Stand 2019). Die meisten Versuche davon werden an sogenannten Altweltaffen durchgeführt. Dazu zählen vor allem Javaneraffen und Rhesusaffen, in kleinerer Zahl aber auch grüne Meerkatzen und Paviane. Darüber hinaus werden Halbaffen und Neuweltaffen für Tierversuche genutzt. Alle Arten werden speziell für die Forschung gezüchtet und stammen nicht aus der freien Wildbahn. An Menschenaffen, wie Schimpansen, Gorillas oder Orang-Utans, werden in Deutschland seit 1991 und seit 2002 in der gesamten Europäischen Union keine Versuche mehr durchgeführt. Die EU-Richtlinie zum Schutz von Versuchstieren verbietet das zudem seit 2010 (VERLINKUNG zu weiteren Informationen im FAQ/der EU-Richtlinie).
Eine besondere Bedeutung haben Affen für die Neurowissenschaften, da die Funktionsweise ihres Gehirns der des Menschen sehr ähnlich ist. An Affen können Forscher daher Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche gut untersuchen, zum Beispiel Depressionen, Schizophrenie und Autismus. Durch Studien an Affen wissen wir heute, dass diese Krankheiten eng mit Funktionsstörungen des Frontallappens und daraus resultierenden Interaktionen mit anderen Teilen des Gehirns zusammenhängen. Daneben werden an Affen die Auswirkungen von Kopfverletzungen, Parkinson, Demenz oder Schlaganfällen erforscht, um durch das bessere Verständnis dieser Krankheiten Medikamente und Therapien entwickeln zu können.
Affen dienen außerdem der Untersuchung von Infektionskrankheiten, da sie ein ähnliches Immunsystem besitzen wie der Mensch. Ein anschauliches Beispiel ist Malaria: Affen können die Infektion in sich tragen, ohne dass sie ernsthafte Krankheitssymptome zeigen. Dennoch lassen sich die Infektion und ihr Verlauf gut an ihnen erforschen. Auf dieser Grundlage entwickeln und testen die Forscher Impfstoffe und Medikamente. Des Weiteren konnten Affen bereits wichtige Erkenntnisse über Infektionskrankheiten wie Hepatitis (Entzündung der Leber), HIV, Tuberkulose und Ebola liefern.
Die meisten Versuche an Affen in Europa dienen gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitstests für Medikamente. Dadurch sollen eventuelle Risiken ausgeschlossen werden, bevor das Medikament in einer klinischen Studie am Menschen getestet wird.
Zu den wichtigsten medizinischen Erfolgen, an denen Untersuchungen an Affen beteiligt waren, zählen: Impfungen gegen Kinderlähmung, Masern, Röteln und Mumps, Hepatitis B und Diphterie sowie die Entwicklung antiviraler Therapien für HIV-Infizierte, Rehabilitationstherapien für Schlaganfallpatienten, die Entwicklung von Bluttransfusionen sowie Therapien für Frühgeburten.
Meerschweinchen

Die Forschung nutzt Meerschweinchen bereits seit 200 Jahren. Sie zählen zu den ersten Tieren, an denen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Diphterie näher untersucht wurden. Zahlreiche große Forschungserfolge wurden durch die Arbeit an Meerschweinchen erst möglich: 1901 erhielt der Arzt Emil von Behring den ersten Nobelpreis für Medizin für seine Erforschung des Diphtherie-Erregers. 1905 wurde der Mediziner Robert Koch für seine Entdeckungen im Bereich der Tuberkulose mit dem Preis geehrt. Durch die Entwicklung von Impfstoffen gegen diese Krankheiten haben Behring und Koch bis heute vielen Millionen Menschen das Leben gerettet.
Auch heute noch untersuchen Wissenschaftler am Meerschweinchen schwerpunktmäßig bakterielle Infektionen. Denn auf viele dieser Krankheiten, zum Beispiel am Auge oder an der Lunge, zeigt ein Meerschweinchen ähnliche Reaktionen wie ein Mensch. So können die Forscher Vergleiche in der Immunabwehr oder der Hormonreaktion ziehen. Gleiches gilt für Allergien oder Atemwegserkrankungen wie Asthma: Medikamente zum Inhalieren wurden vorab häufig an Meerschweinchen entwickelt und getestet, da ihre Atemwege auf Allergene besonders sensibel reagieren. Heute wird auf diesem Forschungsfeld häufig die Maus genutzt.
Wichtige Erkenntnisse konnten Wissenschaftler darüber hinaus durch Untersuchungen am Ohr des Meerschweinchens gewinnen, das sich aufgrund der ähnlichen Anatomie des Mittelohres für Vergleiche zum Menschen besonders gut eignet. Des Weiteren ziehen Wissenschaftler die Tiere für Ernährungsstudien, die Entwicklung eines Herzklappenersatzes, Untersuchungen von Bluttransfusionen, die Entwicklung von Antibiotika für die Nierendialyse und von Gerinnungshemmern heran. Eine wichtige Rolle haben Meerschweinchen für die Entdeckung von Beta-Blockern gegen Bluthochruck gespielt sowie für Medikamente, mit denen Magengeschwüre erfolgreich behandelt werden können.
Insgesamt ist der Einsatz von Meerschweinchen für die Forschung in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Wurden 2009 noch 29.566 Tiere eingesetzt, waren es 2014 nur 20.576. Der Grund dafür ist, dass Meerschweinchen inzwischen dank neuer und schonenderer Alternativen seltener für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitstests verwendet werden müssen. Wissenschaftler stellen heute beispielsweise menschliche Haut künstlich her. Dadurch entfallen einige gesetzlich vorgeschriebene Arzneimittel- und Chemikalientests, die zuvor am Meerschweinchen durchgeführt wurden.
Case: Diphterie
Bei der Diphterie handelt es sich um eine bakterielle Infektion der Atemwege, die durch Tröpfchen übertragen wird. Die Bakterien greifen die Schleimhäute an, die Konsequenzen sind neben einem entzündeten Nasen- und Rachenraum starke Schwellungen von Hals und Gesicht. Viele Betroffene, darunter vor allem Kinder, bekommen während des Krankheitsverlaufs immer schlechter Luft und ersticken qualvoll. Noch Ende des 19. Jahrhunderts forderte die hoch ansteckende Krankheit unzählige Todesopfer: Allein in Preußen starben zwischen 1881 und 1886 durchschnittlich 25.000 Kinder pro Jahr an der Diphtherie.
Von diesen Eindrücken sehr geprägt, begannen die Ärzte Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato mit Nachdruck, die Krankheit zu erforschen. Sie hofften, eine wirksame Therapie zu entwickeln. Ihr Ansatzpunkt war das Wissen darum, dass es bei Seuchen immer Personen gibt, die nicht oder nur in geringem Maß von der Krankheit betroffen sind. 1889 gelang den beiden Forschern schließlich der Durchbruch im Experiment an Meerschweinchen: Behring und Kitasato beobachteten, dass einige der Meerschweinchen immun gegen den Diphtherie-Erreger zu sein schienen. Ihre Theorie: Es muss Antikörper im Blut geben, die Immunität hervorrufen können. Um dies zu beweisen, spritzten sie gesunden Meerschweinchen abgeschwächte Diphtherie-Erreger. Und tatsächlich: Sie entwickelten eine höhere Widerstandskraft gegen die Krankheit. Aus erkrankten Tieren gewannen die Forscher ein Antiserum, das sie in weiteren Studien sowohl infizierten als auch gesunden Meerschweinchen spritzten. Das Ergebnis: Ein Teil der infizierten Tiere erholte sich gut und die gesunden Tiere erkrankten nicht.
Doch bis diese Therapie flächendeckend beim Menschen angewendet werden konnte, war es noch ein langer Weg. Der Hauptgrund dafür lag in der großen Menge an Antikörpern, die für die Behandlung eines Menschen nötig waren. Dafür griff Behring zunächst auf größere Tiere wie Schafe und Pferde zurück. Die aufwändige Haltung ließ aber schon sehr bald die Kosten explodieren. Hilfe fand Behring schließlich in einer Kooperation mit der Industrie: 1892 schloss er einen Vertrag mit den „Farbwerken Hoechst“ in Frankfurt und sicherte sich so die nötige finanzielle Unterstützung. Das Unternehmen weihte zwei Jahre später eine Produktionsstätte mit 57 Pferden ein.
1891 testete Behring das Serum erstmals am Menschen – aufgrund der zu geringen Wirkstoffmengen allerdings mit mäßigem Erfolg. Um diese Werte zu optimieren, knüpfte Behring weitere Kooperationen in der Wissenschaft: Der Chemiker und Mediziner Paul Ehrlich entwickelte ein Verfahren, mit dem er die Antiköper im Blut der Tiere steigern und anhand von Gewicht und Alter die richtige Dosierung ermittelt werden konnte – mit durchschlagendem Erfolg: 1894 heilt er in einer klinischen Studie 102 von 108 an Diphterie erkrankten Kindern. Die Massenproduktion des Heilmittels begann. Hunderttausenden Kindern rettete Behrings Serumtherapie seitdem das Leben.
1904 trennte Behring sich von den „Farbwerken Höchst“ und gründete zusammen mit Carl Siebert sein eigenes Unternehmen, die Behring-Werk OHG.
Für seine Entdeckung wurde Emil von Behring mit allen wissenschaftlichen Auszeichnungen seiner Zeit geehrt, darunter auch 1901 der erste Nobelpreis für Medizin. Er wurde als „Retter der Kinder“ gefeiert und erhielt Zeit seines Lebens Dankesbriefe von Eltern, deren Kinder durch sein Serum geheilt werden konnten.
In Deutschland taucht Diphterie heute dank flächendeckender Impfung kaum noch auf: 97 Prozent besitzen einen Impfschutz. Die Erforschung der Diphtherie im Tierversuch war somit der Ausgangspunkt für eine der größten Erfolgsgeschichten in der medizinischen Forschung.
Zebrafisch

Der Zebrafisch ist seit den 1990er Jahren nicht mehr nur als Zierfisch bekannt, sondern auch als äußerst aufschlussreiches Forschungsmodell.
Viele Fragestellungen lassen sich deshalb so gut am Zebrafisch untersuchen, weil sich die Eier des Fisches außerhalb des Mutterleibs entwickeln und durchsichtig sind. Dadurch können die Forscher die Entwicklung der Zellen und Organe gut beobachten, ohne die Embryonen verletzen zu müssen. Es ist zum Beispiel zu sehen, wie das Herz anfängt zu schlagen und die Blutgefäße wachsen. Außerdem besitzt der Fisch eine erstaunliche Selbstheilungsfähigkeit: Ihm wachsen zum Beispiel abgetrennte Flossen nach, er kann das Herz-Muskelgewebe bis zu 20 Prozent reproduzieren, teilweise heilen bei ihm sogar Nieren- oder Rückenmarksverletzungen und er kann neue Nervenzellen aus neuronalen Stammzellen bilden. Durch die Forschung am Zebrafisch erhoffen sich die Wissenschaftler therapeutische Ansätze für die Neubildung von menschlichen Geweben und Organen.
Im Zebrafisch können Forscher relativ einfach Mutationen auslösen und so gezielt die Auswirkungen von Genveränderungen auf den Organismus untersuchen. Daraus haben sie bereits wichtige Erkenntnisse über Humankrankheiten gewonnen, wie Alzheimer, angeborene Herzfehler, Krebs oder Nierenerkrankungen.
Frettchen
Frettchen werden eher selten für Versuchszwecke verwendet – 2014 waren es in Deutschland 159 Tiere. Das entspricht 0,01 Prozent aller eingesetzten Versuchstiere. Dennoch nehmen sie in der biomedizinischen Forschung einen hohen Stellenwert ein. Sie werden unter anderem für spezifische Fragestellungen, die Herz, Gehirn, Fortpflanzung, Seh- und Hörvermögen oder Magenfunktionen betreffen, herangezogen. Daneben ist das Frettchen das am besten geeignete Tier, um Grippeviren zu untersuchen und wirksame Impfstoffe zu entwickeln und zu testen – denn das Frettchen kann genauso wie der Mensch an der Grippe erkranken. Die Infektion verläuft hinsichtlich der klinischen Anzeichen, des Krankheitsverlaufs und der Immunologie sehr ähnlich. Mit Hilfe von Frettchen erfahren Forscher daher mehr über altersbedingte Anfälligkeit sowie über den Entwicklungsprozess, die Übertragungswege und Varianten einer Grippe-Infektion. Indem Frettchen Anti-Serum vergangener Grippe-Infektionen übertragen wird, simulieren Forscher eine natürliche Infektion und können so verschiedene, auch neue Virenstämme differenzieren.
Katzen
0,04 Prozent aller in Deutschland eingesetzten Versuchstiere sind Katzen. In der Forschung haben sie über Jahrzehnte hinweg zu bahnbrechenden Entwicklungen beigetragen, insbesondere in der Erforschung des Nervensystems und der Sinnesorgane. Durch Versuche an Katzen haben wir heute ein besseres Verständnis von Emotionen, Herzkrankheiten, Diabetes, Taubheit, Sehstörungen und Rückenmarksverletzungen.
In Versuchen mit Katzen gewonnenen Erkenntnisse kommen oftmals wieder Katzen zu Gute. Ein Beispiel ist die sogenannte Katzenleukose, eine der häufigsten infektiösen Todesursachen bei Katzen. 1965 entdecken Wissenschaftler, dass bei Katzen Blutkrebs (Leukämie) durch einen Retrovirus hervorgerufen wird und legten damit die Basis für die Entwicklung eines für unsere Hauskatzen erhältlichen Impfstoffs, der sie vor der Erkrankung schützt. Da die Krankheit der menschlichen Leukämie sehr ähnlich ist, konnten die Wissenschaftler daraus auch auf den Menschen übertragbare Ergebnisse ableiten.
Eine weitere bei Katzen auftretende Krankheit ist das Feline Immundefizienzsyndrom. 1986 haben Wissenschaftler entdeckt, dass das Katzenvirus „Feline Immundefizienz“ (FIV) durch einen Retrovirus hervorgerufen wird, der dem HI-Virus beim Menschen ähnelt. Seither werden Katzen vermehrt für die AIDS-Forschung eingesetzt. Das FI-Virus kann sich bereits sehr lange im Körper der Katze befinden, bevor die Erkrankung ausbricht. Auch die Symptome sind ähnlich wie bei einer AIDS-Erkrankung. Infizierte Katzen werden daher mit therapeutischen Mitteln behandelt, die auch beim Menschen angewendet werden. Mit Versuchen an Katzen erforschen Wissenschaftler antivirale Behandlungen, die sich auf an HIV erkrankte Personen übertragen lassen. Für die Zukunft erhoffen sich die Wissenschaftler, auf dieser Grundlage einen Impfstoff entwickeln zu können.
Ihr feines Gehör, ihr präzises Sehvermögen sowie ihr ausgeprägter Räumlichkeits- und Gleichgewichtssinn machen die Katze besonders für die Erforschung sensorischer Systeme interessant. Dadurch haben Wissenschaftler bereits verschiedene Funktionen des Nervensystems entschlüsselt. Ein Beispiel sind die Forschungsergebnisse von David Hubel, für die er 1981 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde: Hubel fand heraus, dass das visuelle System von Säugetieren – und somit auch des Menschen – bei der Geburt erst teilweise entwickelt ist. Indem er das Nervensystem junger Tiere untersuchte, konnte Hubel beweisen, dass sich erst durch Lichtstimulationen der visuellen Neuronen das Auge, der optische Nerv und das Sehzentrum im Gehirn vollständig entwickeln.
Weitere Bereiche, in denen Katzen für die Forschung eingesetzt werden, sind die Alterungsforschung und Untersuchungen der Lernfähigkeit. Katzen eignen sich dafür besonders gut, weil sie verglichen mit anderen Tierarten eine hohe Lebenserwartung haben sowie über eine scharfe Wahrnehmung und ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen..
Hunde
Hunde spielen bereits seit dem 17. Jahrhundert für Wissenschaftler eine wichtige Rolle, um an ihnen Behandlungsmethoden sowie die Funktionsweise des Organismus zu studieren. In 2014 wurden 4636 Hunde für Tierversuche eingesetzt – das entspricht gemessen an der Gesamtzahl aller Versuchstiere 0,2 Prozent. 75 Prozent der Hunde wurden für gesetzlich vorgeschriebene Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen herangezogen.
Mit Hilfe von Hunden wurden unter anderem das Diabetes-Medikament Insulin sowie zahlreiche Impfstoffe entwickelt. Ein Beispiel ist die Tollwut-Impfung, die der französische Chemiker und Mikrobiologe Louis Pasteur 1880 entwickelte. In seinen Studien erkannte Pasteur, dass er Hunde gegen das Virus immunisieren kann, indem er ihnen über einen gewissen Zeitraum eine abgeschwächte Virus-Variante verabreichte. Es gelang Pasteur, dieses Verfahren auf den Menschen zu übertragen – mit durchschlagendem Erfolg: Von 350 behandelten Personen erkrankte nur eine an Tollwut. Pasteurs Verfahren wurde bis nach dem Zweiten Weltkrieg angewandt, danach konnte der Impfstoff durch ein Präparat ersetzt werden, das in Zellkulturen hergestellt wird.
Für die Erforschung des Verdauungssystems an Hunden wurde Ivan Pavlov 1904 mit dem Nobelpreis geehrt. Pavlov gab eine genaue Beschreibung darüber ab, wie die Bauchspeicheldrüse, der Magen und die inneren Organe beschaffen sind und bewies, dass Verdauungstrakt und zentrales Nervensystem eng zusammenhängen.
Wichtige medizinische Fortschritte konnten auch in Bezug auf Herzerkrankungen durch Versuche an Hunden erzielt werden. An ihnen wurde beispielsweise die Technik der Bluttransfusion entwickelt, ohne die heute viele Operationen nicht möglich wären. Jean Louis Prevost und Frederic Batelli fanden 1899 heraus, dass sie durch Stromreize bei einem aus dem Takt geratenen Hundeherz den normalen Rhythmus wieder herstellen konnten. Damit war der erste Defibrillator geschaffen. In den folgenden Jahren wurde das Prinzip, das 1947 erstmals am Menschen verwendet wurde, stetig verfeinert. Heute sind an vielen öffentlichen Orten einfach zu bedienende Defibrillatoren hinterlegt, die inzwischen unzähligen Menschen mit einem Herzkammerflimmern das Leben gerettet haben.
Auch Herzschrittmacher und künstliche Herzklappen würde es heute vermutlich ohne Versuche an Hunden nicht geben: Forscher implantierten Hunden die ersten Herzklappenmodelle in den 1950er-Jahren. Die Modelle wurden verbessert, bis sie 1961 schließlich erstmals auch einem Menschen eingesetzt werden konnten. Parallel zu dieser Entwicklung ging die Forschung an Transplantationen von Herzklappen voran: In den frühen 1970ern wurden Hunden erstmals sogenannte Xenotransplantate von Kälbern, Ziegen, Schweinen und Schafen eingesetzt. Damit waren Mediziner nicht mehr auf die nur unzureichend vorhandenen Spenderorgane von Menschen angewiesen.
Untersuchungen an Hunden brachten entscheidende Fortschritte bei der Entwicklung des Elektrokardiogramms (EKG). Heute zählt das EKG zu den Standardinstrumenten, mit denen Ärzte die Gesundheit des Herzens überprüfen. Auch Behandlungsmethoden für Muskelerkrankungen und Prostatakrebs sind auf die Forschung an Hunden zurückzuführen.
Beeindruckende Ergebnisse erzielten Wissenschaftler 2012 durch Zelltransplantationen bei Dackeln mit Rückenmarksverletzungen, die eine Lähmung der Beine verursachten: Indem die Forscher Geruchszellen aus der Nase des Tieres in das Rückenmark injizierten, heilte die Verletzung und die Hunde konnten wieder laufen. Die Forscher erhoffen sich, dass sie daraus wirksame Therapien für vergleichbare Verletzungen beim Menschen ableiten können.






