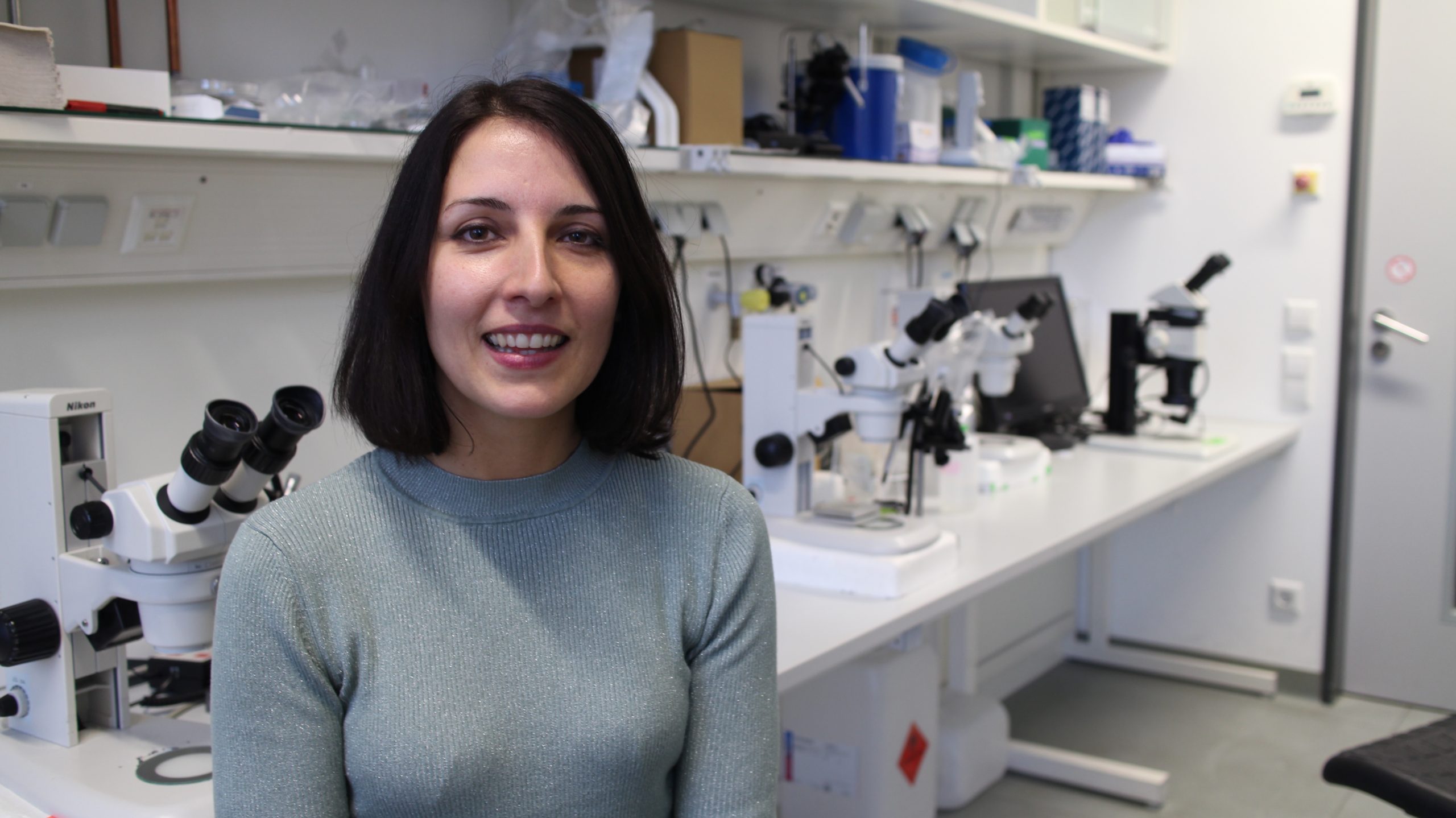Schlummern im menschlichen Erbgut noch die Anlagen zur Regeneration ganzer Körperteile? Dr. Kerstin Bartscherer forscht in Münster, um den Mechanismen der Regeneration auf die Spur zu kommen. Im Moment arbeitet sie mit Plattwürmern, in Zukunft auch mit ganz besonderen Mäusen. Früher konnte sie buchstäblich keiner Fliege etwas zuleide tun und verweigerte selbst im Studium das Töten einer Maus. Das Thema Tierversuche sieht sie heute differenzierter.
Bei manchen Tieren heilen Verletzungen auf eine besondere Art und Weise. So sind einige Würmer, Seesterne, Fische, Amphibien und Reptilien in der Lage, einzelne Körperteile neu zu bilden. Flossen, Beine, Arme oder auch innere Organe wachsen nach einem Verlust wieder nach. Selbst einige Säugetierarten haben die Fähigkeit zur Regeneration. Haben sie sich diese über Jahrmillionen der Evolutionsgeschichte bewahrt oder ganz neu angeeignet? Und was wäre, wenn im menschlichen Erbgut ebenfalls die Anlage zur Regeneration schlummert? Wie funktioniert erfolgreiche Regeneration? Dr. Kerstin Bartscherer ist dem Geheimnis der Regeneration auf der Spur. Sie leitet am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster eine Forschergruppe. Der genaue Blick auf die Regenerationsprozesse von Plattwürmern soll sie einer Antwort näher bringen.
Im Büro von Kerstin Bartscherer hängen viele Bilder an hohen Wänden. Sie zeigen ihre Kollegen, Fotos aus dem Laboralltag, aber auch Übersichten komplexer molekularer Prozesse und bunte Mikroskopaufnahmen. Eines der Fotos zeigt Kinder in übergroßen Laborkitteln. Wissenschaft findet nicht nur unter dem Mikroskop statt. „Wir haben oft Besuchergruppen hier und ich zeige gerne, was wir hier erforschen“, sagt die Wissenschaftlerin. Erst kürzlich hielt sie einen öffentlichen Vortrag im Rahmen des ersten Max-Planck-Forums in Münster, für den sie viel Zuspruch aus dem Publikum erhielt.
Plattwürmer verfügen über beinahe unbegrenzte Regenerationsfähigkeiten
„Regeneration, das heißt, etwas Kaputtes wieder neu herzustellen, und zwar so, wie es vorher war“, erklärt Bartscherer. „Die Frage, die uns beschäftigt, ist: Warum heilen bei manchen Tieren Verletzungen mit der Bildung von Narben aus, während andere Wunden vollständig heilen oder Gewebe und Organe sogar ganz nachwachsen?“ Die Antwort auf diese Frage sucht Bartscherer mit Hilfe von Plattwürmern. Diese sind zwar nur einige Milliimeter lang, verfügen jedoch über beinahe unbegrenzte Regenerationsfähigkeiten. „Teilt man einen Wurm in viele kleine Stücke, wächst aus jedem Teil ein vollständiges, neues Individuum“, erzählt die Wissenschaftlerin. Nahezu alle der zahlreichen Exemplare am Institut in Münster seien somit aus sehr wenigen „Vorfahren“ entstanden.
Die kleinen wirbellosen Tiere kommen in der Natur in Gewässern vor und ernähren sich von organischem Material. Im Institut leben sie in einem separaten Raum in unscheinbaren Plastikbehältern, die mit Wasser gefüllt sind, und bekommen Rinderleber in Bioqualität als Futter. Die Forscherin untersucht anhand dieser Tiere, welche Zellen welche Funktionen bei der Regeneration übernehmen und welche Steuerungsprozesse dahinter stecken. „Natürlich haben wir die Hoffnung, dass unsere Ergebnisse irgendwann einmal für die Medizin relevant werden. Und da stößt man mit der Erforschung der Plattwürmer wegen ihrer großen evolutionären Distanz zum Menschen irgendwann an Grenzen.“ Der nächste Schritt erscheint daher für sie unumgänglich: „Um nicht gegen eine Wand zu laufen, müssen wir daran arbeiten, unsere Ergebnisse auf Wirbeltiere übertragen“. Wirbeltiere sind dem Menschen in vielerlei Hinsicht deutlich ähnlicher als die Würmer. Daher arbeitet Bartscherer seit einigen Jahren erfolgreich mit Forschern zusammen, die Regenerationsprozesse in Fischen untersuchen. Vor kurzem hat auch ein besonderes Säugetier ihre Aufmerksamkeit erlangt: die afrikanische Stachelmaus. Dieses Nagetier ist das bisher einzig bekannte Säugetier, das seine Haut, und sogar Knorpel, in großem Umfang regenerieren kann. Dieser Trick stellt in der Natur für die Tiere wohl einen evolutionären Vorteil dar: Einen Angriff, zum Beispiel von einer Schlange oder einem Greifvogel, parieren Stachelmäuse, indem sie Teile ihrer Haut abstreifen. Dabei entstehen riesige Wunden, die aber in kurzer Zeit komplett zuwachsen – ohne Narben, dafür mit neuem Fell. Wie die Tiere das schaffen und ob die molekularen und zellulären Prozesse die gleichen sind wie bei den Plattwürmern – diesen Fragen will Bartscherer nun nachgehen.
Nach und nach verändert sich die Einstellung zu Tierversuchen
Dabei fiel der engagierten Wissenschaftlerin die Forschung an Mäusen, Würmern und Insekten anfangs keineswegs leicht. Sie wuchs mit Hunden und Katzen auf, verweigerte dann im Molekularbiologie-Studium aus Gewissensgründen die Tötung einer Maus und nahm dafür eine schlechte Note in Kauf. „Damals wollte ich nicht einmal eine Mücke töten. Ich habe sie lieber gefangen und raus gebracht. Als junge Doktorandin konnte ich es kaum mit meinem Gewissen vereinbaren, Fruchtfliegen zu töten. Das war für meine Forschung aber nötig“, schildert sie ihre Erfahrungen. Heute beschreibt sie sich noch immer als äußerst tierlieb, isst kein Fleisch, nur gelegentlich Fisch. Nach und nach veränderte sich aber insbesondere ihre Einstellung zu Tierversuchen. „Je weniger man sich mit dem Thema beschäftigt, desto einfacher ist es, gegen Tierversuche zu sein“, beschreibt sie den Prozess. Ihre Begeisterung für ihr Forschungsthema und die Erwartungen an die regenerative Medizin, die sie damit verknüpft, haben sie nach dem Studium zur Forschung mit Tieren gebracht. Sie forschte und veröffentlichte sehr erfolgreich auf dem Gebiet der Regeneration und steht jetzt kurz vor ihrer Habilitation.

Auftrieb bekommt ihre Forschung auch durch neueste Erkenntnisse von Kollegen aus dem Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. Hier wurde kürzlich die Entschlüsselung der Genome der Plattwürmer und des Axolotls vorgestellt. Der Axolotl ist ein Lurch, der ebenfalls über außergewöhnliche Regenerationsfähigkeiten verfügt. „Die neuen Ergebnisse der Kollegen aus Dresden sind für meine Arbeit – und die der weltweiten Community – extrem wichtig“, sagt Bartscherer. Nur mit der Verfügbarkeit von hochwertigen Genomsequenzen könne die Regeneration dieser Tiere genau verstanden, und wichtige Unterschiede zwischen Tieren mit unterschiedlichen Regenerationsfähigkeiten aufgedeckt werden, so die Forscherin weiter.
Nach heutigen Erkenntnissen verhalten sich menschliche Zellen bei Verletzungen anders als die der Plattwürmer und Stachelmäuse. Narbenbildung schränkt die Regeneration beim Menschen ein. Bartscherer treibt die Idee an, dass eine Verbesserung der Regenerationsfähigkeit von Menschen möglich ist. Davon könnten zum Beispiel Patienten mit schweren Verbrennungen profitieren. „Wir haben die nötige Hardware; die Schalter müssen nur umgelegt werden“, ist sich Bartscherer sicher. Denn die Signalwege, mit der die Zellen sich bei der Wundheilung untereinander absprechen und ihre Aufgaben koordinieren, sind bei allen Tieren trotz der sichtbaren Unterschiede erstaunlich ähnlich. „Evolutionär konserviert“ nennen die Forscher das.
Open-Science-Ansätze unterstützen
Das Thema Tierversuche hat Bartscherer für sich nach und nach neu bewertet. Es ist eine Abwägung zwischen Tierwohl und Erkenntnisgewinn, sowie dem möglichen, zukünftigen Nutzen für die Menschen. Sie betont, dass ihre zukünftigen Versuche nicht mit schweren Belastungen für die Mäuse verbunden seien. Zum Beispiel stanzen die Forscher den Stachelmäusen ein Loch in die Ohren und untersuchen Gewebe, Zellen und Genaktivierung während das Loch heilt, ohne dass die Verletzung Spuren hinterlässt. Ihre Ergebnisse möchte Bartscherer schnell weltweit für wissenschaftliche Kollegen zugänglich zu machen und damit sogenannte Open-Science-Ansätze unterstützen. Unnötige Mehrfachversuche sollen so vermieden werden, erklärt sie. „Die Stachelmäuse könnten einen ‚missing link‘ zwischen Alleskönnern wie Plattwürmern und nicht-regenerationsfähigen Säugetieren ersetzen und so die bisherigen Ergebnisse besser auf den Menschen übertragbar machen.“
In ihrem Büro fällt der Blick wieder auf die Fotos über dem Schreibtisch. Ein Kind aus der Gruppe der „kleinen Forscher“ ist die Tochter von Kerstin Bartscherer. „Mit der Geburt meiner eigenen Kinder hat sich meine Einstellung zu Tierversuchen noch einmal verändert“, betont sie mit Blick auf den medizinischen Fortschritt, der ohne Tierversuche nicht möglich gewesen wäre. „Ich pflege einen offenen Umgang mit ihnen über das Thema Tierversuche, trotzdem sind sie natürlich grundsätzlich gegen das, was ich im Labor mache. Kinder fühlen halt so.“