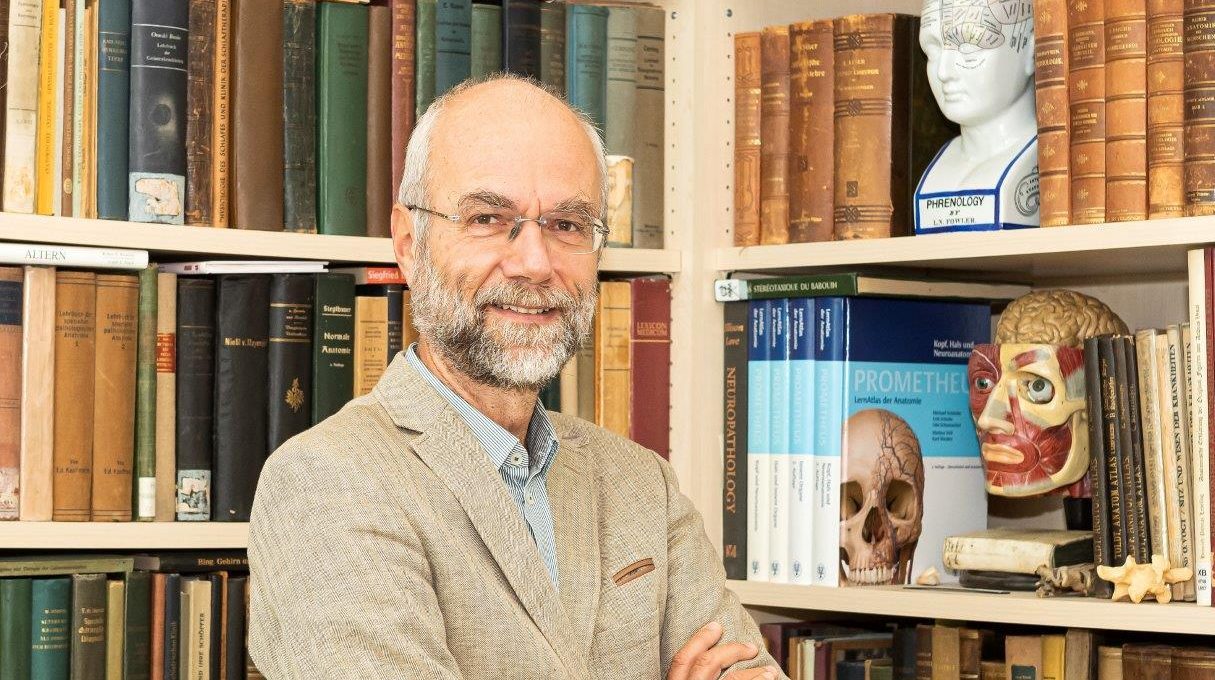Die Diagnose „Alzheimer-Demenz“ ist seit Entdeckung der Erkrankung für Betroffene mit einer gewissen Hilflosigkeit verbunden. Der Arzt Alois Alzheimer hatte die Erkrankung 1906 beobachtet. Es gibt derzeit nämlich keine Therapie, die das Sterben der Nervenzellen im Gehirn und damit den geistigen Verfallsprozess verlangsamen oder sogar stoppen könnte. Prof. Thomas Arendt erforscht die Krankheit seit mehr als 30 Jahren; er weiß um die Erfolge und Rückschläge des Forschungsprozesses.
Eine Studie aus Arendts Labor erklärt möglicherweise manche Rückschläge bei der Übertragung von Ergebnissen aus bestimmten Tiermodellen, die in der Alzheimer-Forschung häufig benutzt wurden. Tierversuche verstehen hat den Leiter des Paul-Flechsig-Instituts für Hirnforschung der Universität Leipzig gefragt, was die Forschung aus bisherigen Erkenntnissen lernen kann und welche Perspektive er für die Zukunft sieht.
Herr Prof. Arendt, in Tiermodellen sind schon viele therapeutische Verfahren gegen die Alzheimer-Krankheit entwickelt worden. Keines hat Patienten bisher geholfen. Woran liegt das?
Prof. Thomas Arendt: Das ist genau das Thema unserer aktuellen Veröffentlichung: Es gibt eine Reihe an Genen, deren Aktivität mit der Alzheimer-Krankheit in Zusammenhang steht. Dies betrifft insbesondere Gene, die erst im Laufe der menschlichen Evolution zur Ausprägung gekommen sind. Die aktuellen Tiermodelle sind fast ausschließlich transgene Mäuse, die die Entwicklung der Krankheit daher nicht gut abbilden können. Evolutionär gesprochen, sie sind einfach zu weit weg von der Komplexität, der wir uns bei dieser Erkrankung gegenübersehen. Dies kann als ein Hinweis gedeutet werden, dass es etwas spezifisch Menschliches geben muss, das die Erkrankung bedingt.
Haben Sie eine Idee, was das sein könnte?
Arendt: Wir wissen nicht genau was das ist, aber unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass es erst in der jüngeren Evolutionsgeschichte dazugekommen ist. Und das betrifft genau die Hirnfunktionen, die uns als Menschen ausmachen. Genau diese Funktionen sind es, die durch die Alzheimer-Krankheit gestört werden. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass die evolutionär erworbene hochgradige Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns und die in höherem Lebensalter auftretende Störanfälligkeit des Gehirns zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Der Mensch ist offensichtlich nicht dafür gemacht, so alt zu werden. Das lässt sich nicht in Tiermodellen nachbilden.
Sind Tierversuche für die Erforschung von Alzheimer also nicht geeignet?
Arendt: Ich habe jetzt ausdrücklich von Tiermodellen gesprochen, die also versuchen, die Erkrankung des Menschen im Tier nachzubilden. Das soll nicht heißen, dass Tierexperimente grundsätzlich ungeeignet sind! Natürlich sind Tierexperimente wichtig und werden es auch immer bleiben, weil wir gar keinen anderen Zugang zu den dynamischen Prozessen im Säugetiergehirn haben. Aber, wir sollten insbesondere versuchen, das menschliche Gehirn noch besser zu verstehen, also zum Beispiel die Gehirne von verstorbenen Patienten untersuchen.
Das ist natürlich ein totes Gewebe, mit dem man keine zellbiologischen Untersuchungen mehr machen kann. Der Ausgangspunkt für neue Hypothesen sollte aber immer aus der Beobachtung des menschlichen Gehirns kommen. Die hieraus abgeleiteten Hypothesen müssen im Experiment am Tier überprüft werden. Das geht nicht allein mit in vitro Methoden, denn dort ist die Komplexität zu niedrig. Dafür brauchen wir immer auch Tierexperimente.
Welche Teilaspekte der Alzheimer-Krankheit können mit heutigen Tiermodellen untersucht werden und welche nicht?
Arendt: Wir sind heute aufgrund des technisch-methodischen Fortschritts extrem weit in die molekularen Mechanismen des Lebens vorgedrungen. Das Problem ist nur, dass die Biologie zellbiologisch funktioniert, nicht rein molekular. Biologie ist keine reine Chemie, sondern geht eben darüber hinaus. Wir wissen, dass alle Organismen trotz der großen Vielzahl möglicher Schädigungen immer nur ein sehr begrenztes Antwortverhalten auf diese Schädigungen zeigen, sprich, dass es nur eine begrenzte Zahl von Krankheitsmechanismen gibt.
Streng genommen kann man daher alle Erkrankungen auf drei grundlegende zellbiologische Prinzipien zurückführen: Das sind der Zelltod, also etwa Neurodegeneration wie bei Alzheimer, die Zellneubildung, also eine gestörte Kontrolle der Zellteilung wie bei Krebs-Erkrankungen, oder die Entzündung. All diese Prinzipien spielen bei Alzheimer eine Rolle.
Das bedeutet für mich, dass wir stärker die zellbiologische Ebene im Blick haben sollten – ohne natürlich die molekulare Ebene zu vernachlässigen.
Schwierigkeiten bei Tiermodellen
Was müsste ein ideales Tiermodell in der Alzheimer-Forschung leisten?
Arendt: Wir vergessen oft: Die Alzheimer Erkrankung entwickelt sich sehr langsam. Es gibt eine meist jahrzehntelange Phase, in der von den Patienten noch keine Symptome bemerkt werden. Nach der Diagnose, wenn also Symptome auftreten und die Erkrankung ausgebrochen ist, besteht noch eine weitere Lebenserwartung von etwa 8 bis 10 Jahren. Der menschliche Krankheitsprozess braucht insgesamt also ungefähr 30 Jahre, bis er zum Tod führt. Das blenden wir in der Forschung häufig aus, denn ein Experiment, was diesen Prozess von über 30 Jahre nachbildet, können wir nicht machen.
Der Auslöser dieses Prozesses, die erste krankhafte Veränderung, muss anfangs sehr klein sein, um über die lange Zeit hinweg zu den großen Auswirkungen zu kommen. Eine gravierende Veränderung würde deutlich schneller zum Tod führen. Diese Herausforderung, eine derartig geringfügige Störung zu identifizieren, wird leider bisher in der Forschung nicht adressiert. Ich habe dazu leider auch keine Lösung.
Klar ist für mich aber: Die verfügbaren Alzheimer-Tiermodelle verursachen in den Tieren relativ akute Schädigungen, die sehr schnell zur Erkrankung führen. Das ist etwas grundsätzlich anderes, als wenn eine Zelle ganz, ganz langsam stirbt. Ich möchte dennoch betonen, dass die zellbiologischen Mechanismen bei einer Maus nicht grundsätzlich anders sind als bei einem Menschen und man solche Aspekte immer wieder im Tierexperiment testen muss, um sich den möglichen Ursachen anzunähern.
Können verschiedene Untersuchungsmethoden kombiniert werden, um die Schwächen von heutigen Tiermodellen auszugleichen?
Arendt: Man muss die verschiedenen zellbiologischen Ansätze aus unterschiedlichen Ebenen kombinieren. Das ist sehr vielfältig. Da reicht eine einzelne Methode nicht aus. Da gibt es sicherlich nicht die eine allumfassende Antwort. Klar ist für mich: Wir müssen unser vorhandenes Wissen besser miteinander vernetzen. Jeder Forscher und jede Forscherin hat in einer ausdifferenzierten Forschung Spezialgebiete. Da müsste mehr über den Tellerrand geschaut werden, was sich jeweils aus den Erkenntnissen anderer ergibt, und wie man dies zu einer umfassenderen Theorie zusammenfassen kann.
Was können neu entwickelte Methoden wie Organoide dazu beitragen?
Arendt: Bei den verschiedenen in vitro Systemen muss man sich im Klaren darüber sein, dass sie die Komplexität der Situation des menschlichen Gehirns nur in sehr reduzierter Form abbilden. Die gewonnenen Ergebnisse gelten nur unter den Bedingungen, unter denen man sie gewonnen hat. Sie sind somit nicht ohne weiteres auf die nächst höhere Komplexitätsebene übertragbar.
Ich kann aus einem in vitro Experiment in einer Petrischale allgemeine Rückschlüsse ziehen, aber es ist nicht das Gleiche, was in einem Gesamtorganismus abläuft.
Natürlich brauche ich in der Forschung einen reduktionistischen Ansatz, sodass ich weniger Komplexität und weniger Variabilität in meinem Experiment habe. Danach muss ich jedoch den Schritt wieder zu höheren Komplexitätsebenen vollziehen. Ich muss irgendwann nach dem Organoid am echten Organ arbeiten. In vitro Methoden können somit immer nur Vorläuferexperimente sein. Ein Organoid bekommt kein Alzheimer. Eine Ratte oder eine Maus auch nicht, und das hat seine Gründe. Vielleicht sollten wir darüber einmal genauer nachdenken.
Tiermodellen liegt ein Konzept zugrunde
Trotzdem werden diese Tiere als Modelle der Erkrankung eingesetzt. Halten Sie das für problematisch?
Arendt: Die zumeist transgenen Mausmodelle, die es für die Alzheimer-Krankheit heute gibt, sind konzeptgetrieben. Das heißt, es liegt ihnen immer eine konkrete Idee zugrunde. Es sind eben keine „kleinen Abbilder“ der Erkrankung, sondern die Veränderungen wurden deshalb vorgenommen, damit man die Konsequenzen dieser Veränderungen untersuchen kann. Ob die Veränderungen an den Tieren wirklich etwas mit der Erkrankung zu tun haben, kann mit dem Modell nicht mehr hinterfragt werden, sondern muss als gegeben angenommen werden.
Das kann ein Trugschluss sein, denn die Veränderungen, die wir in verschiedenen Phasen bei der Erkrankung beobachten, können ja auch Folgen wiederum anderer Prozesse sein, und müssen nicht notwendigerweise Erkrankungsursachen sein. Wenn bestimmte Tiermodelle nicht weiterführen, kann das daran liegen, dass dieser experimentelle Ansatz nicht die tatsächliche Ereigniskette abbildet, die zur Erkrankung führt.
Bleiben Tierversuche auch in Zukunft ein Bestandteil der Alzheimer-Forschung? Gibt es offene Fragen in der Alzheimer Forschung, die sich nur in Tierversuchen beantworten lassen?
Arendt: Trotz all der Einschränkungen, die ich gerade genannt habe, kann man im Tier – im Unterschied zu in vitro Systemen – die notwendige Dynamik in einem gewissen Umfang untersuchen. Es gibt zum Beispiel durchaus auch chronische Tierversuche, in denen man die Entwicklung der Veränderungen im Laufe der Erkrankung verfolgen kann. Da habe ich gar keine andere Möglichkeit als das Tierexperiment, weil mir kein anderes System auf dieser Komplexitätsebene erlaubt, diese Dynamik zu untersuchen. Da ist ein Tierexperiment aktuell noch durch nichts anderes zu ersetzen.
Sind Ihre neuen Erkenntnisse ein Rückschlag bei der Entwicklung von Therapien, oder ein Fortschritt?
Arendt: Das ist eine sehr philosophische Frage. Man kann natürlich sagen, dass jede neue Erkenntnis immer ein Fortschritt ist. Ich sträube mich prinzipiell zu sagen, dass wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt überhaupt je einen Rückschlag bedeuten kann. Unsere Ergebnisse bringen uns nicht unmittelbar einer Therapieoption näher. Sie zeigen aber: Wir müssen vieles noch einmal auf den Prüfstand stellen und einsehen, dass manche Wege vielleicht eine Sackgasse waren. Es ist im Sinne des Erkenntnisgewinns wichtig, dass wir die Prämissen, unter denen wir an Alzheimer forschen, immer wieder kritisch beleuchten. Wir müssen uns erstens stärker auf die zellbiologischen Programme konzentrieren und zweitens den menschenspezifischen Aspekt stärker im Blick haben.
Zukunft der Alzheimer-Forschung
In der Alzheimer-Forschung gibt es aktuell verschiedene Entwicklungen, die das Forschungsgebiet auf andere Bahnen lenken, etwa neuroimmunologische Ansätze oder die Hypothese, dass Infektionen den Krankheitsprozess in Gang bringen. Ist die Forschung auf dem richtigen Weg? Was wäre aus Ihrer Sicht hilfreich?
Arendt: Ich weiß auch nicht, was Alzheimer verursacht, und bin nicht schlauer als andere Forscherinnen und Forscher auf diesem Gebiet. Wissenschaft lebt davon, dass wir andere wissenschaftliche Ansätze nicht geringschätzen. Daher würde ich immer sagen: Alles was neu ist und sich experimentell überprüfen lässt, muss einfach gemacht werden! Es wird nicht alles zum Ziel führen, aber man wird Neues lernen, was bisheriges Wissen relativiert und in einem neuen Licht erscheinen lässt. Deshalb halte ich sowohl die immunologischen Ansätze als auch die Erforschung der natürlichen Funktion des Amyloid-Vorläuferprotein APP für sehr sinnvoll und wichtig. Gerade letzteres ist ein völlig untererforschtes Gebiet. Da bin ich gespannt, wo das hinführt.
Wann wird die Forschung die Krankheit so gut verstanden haben, dass Therapien in Reichweite kommen?
Arendt: Das werde ich ziemlich oft gefragt. Und ich sage meistens: Das dauert mindestens noch eine Generation. Ich werde allerdings zunehmend skeptischer. Es könnte nämlich sein, dass der Auslöser für den Krankheitsprozess in einem Mechanismus liegt, der unser Gehirn überhaupt erst zu einem menschlichen Gehirn macht. Damit wäre Alzheimer sozusagen ein Bauplanfehler. Das bedeutet: Wenn man versucht, an diesem Mechanismus therapeutisch anzusetzen, könnte dies mit der grundlegenden Leistungsfähigkeit unseres Gehirns interferieren und damit fatale Nebenwirkungen hervorrufen. Dann würde es schwierig. Das wissen wir heute noch nicht. Natürlich dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben und es bleibt uns nichts weiter übrig, als unsere Bemühungen zu verstärken, die Krankheit weiter zu erforschen.
Leider sieht man daran, wie auch in der aktuellen Corona-Krise: Die Gesellschaft versteht oft nicht ausreichend, was Wissenschaft eigentlich ist, und wie Erkenntnisgewinn funktioniert. Es ist eben nicht irgendetwas, das auf Knopfdruck die Probleme der Menschheit löst und bedeutet nicht, dass die Forschenden in den Labors doch bitte schnell eine Pille erfinden, mit der man Alzheimer heilt. So funktioniert das eben nicht. Es wird noch sehr lange dauern, bis man diese Prozesse ausreichend verstanden hat und man wird das Problem wohl nicht so einfach durch eine Pille aus der Welt schaffen.
Und deshalb muss man in der Zwischenzeit das Thema Alzheimer von einer anderen Richtung aus betrachten: Die Patienten bestmöglich versorgen und ihre Lebensqualität bestmöglich verbessern, etwa durch passgenaue Demenz-Pflege.
Originalarbeit:
Anne Nitsche, Christian Arnold, Uwe Ueberham, Kristin Reiche, Jörg Fallmann, Jörg Hackermüller, Friedemann Horn, Peter F. Stadler & Thomas Arendt: Alzheimer-related genes show accelerated evolution in Molecular Psychiatry, März 2020.